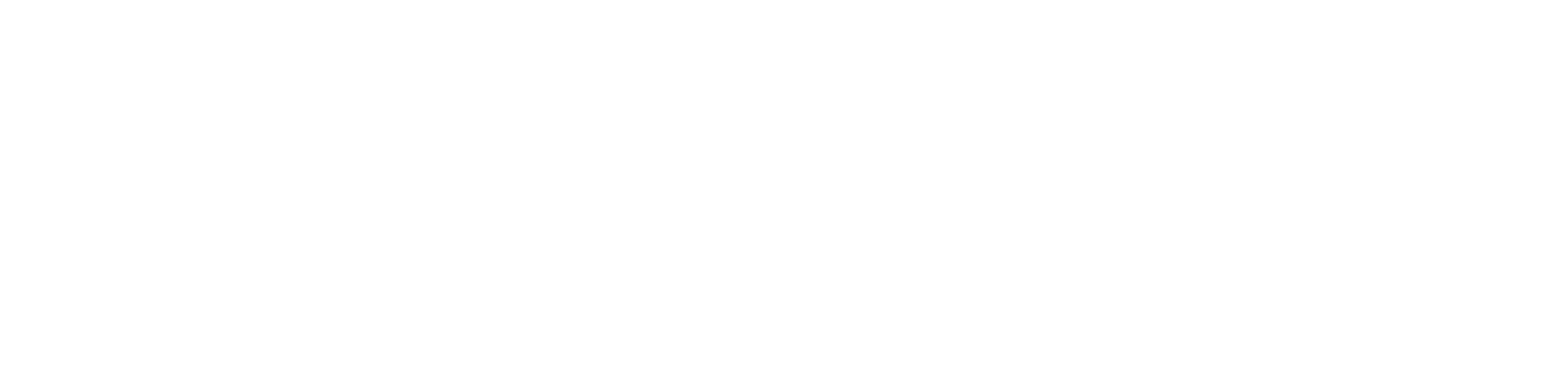Ich erwähne die Postmoderne deshalb, weil ich mich zu erinnern glaube,
dass der Autor, dessen Werk ich nachfolgend rühmen will – und „rühmen“
meine ich hier im besten Sinne – sich selbst ihr zuordnet, während ich
ihn, ob er will oder nicht, in die Moderne, eine neue jedoch, einordnen
werde. Diese Zuordnung hängt mit den Traditonslinien der Hochliteratur
zusammen und nicht nur der deutschsprachigen. Sollte mich meine
Erinnerung trügen – umso besser.
Das erste Buch Herbst', welches ich las, war „Sizilische Reise“. Und
wie der Kurzgeschichtenband „Die Niedertracht der Musik“ (Werke aus der
Zeit von 1972 bis 2004) ist es ein Buch, welches sich einreiht in eine
Traditionslinie von Literatur, die ich nur deshalb nicht Hochliteratur
nennen möchte, weil mir der Begriff bildungsbürgerlich vergellt ist.
Diese Zurückhaltung in der begrifflichen Zuordnung verändert jedoch
nicht die Strecke, zu der, nicht nur diese beiden, Bücher Herbst'
gehören. Nimmt man „Meere“ hinzu, und auf dieses Buch will ich ja
fokussieren, so ist es nicht schwer, Herbst in eine Reihe mit Autoren
zu stellen, die, allerdings nicht ohne Begründung, seine Bedeutung in
der internationalen Literatur beispielhaft herausstellen. Es ist nicht
das Manko des Autors, sondern der gängigen Literaturkritik und ihrer
Ausrichtung an Markt und Macht, welches dazu geführt hat, dass Alban
Nikolai Herbst bislang eine umfängliche Würdigung nicht erhalten hat.
Philip Roth, der spätestens seit dem Erscheinen von „Der menschliche
Makel“ (The Human Stain) Anwärter auf den Literaturnobelpreis ist,
scheint mir, vermutlich zur Verwunderung Vieler, ein Autor zu sein,
dessen Attitüden Herbst sehr nahe kommt. Sowohl die Verliebtheit in
sprachliche Präzision, als auch die Verwendung eben dieser Genauigkeit
zur Aufhebung von eindimensionalen Schilderungen, sowie der Umfang sprachlicher Mittel (und das ist mehr als nur Sprachgewalt), scheint mir
Herbst, der 22 Jahre jünger als Roth ist, in eine Traditionslinie mit
dem großen amerikanischen Autor zu stellen.
Zugleich gibt es weiter
zurückreichende Strecken der Erzählkunst. So hat mich die „Sizilische
Reise“, mehr als jedes andere Werk von Herbst, an jene Tradition
erinnert, die z.B. Thomas Mann, aber auch Alfred Döblin oder Gerhard
Hauptmann, neben anderen, einschließt. Dabei ist es nicht die Art, also
der Mechanismus, des Erzählens, sondern der Subtext, der Sound und die
Gewandheit der Darstellung, die mich Herbst in solche Gesellschaft
stellen läßt.
Den Freund feingesponnener, boshaft verwirrter und zugleich enorm
unterhaltender Literatur wird freuen, dass mir auch Haruki Murakami als
jemand einfällt, dem ich Alban Nikolai Herbst nebenzustellen nicht
abgeneigt bin. Herbst ist Murakami, der immer wieder als
Nobelpreisträger (wie Roth) gehandelt wird, in der Art der Komposition
sicherlich sehr nahe.
 Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Ich bin ein Gegner des
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Ich bin ein Gegner des
Vergleichs von Künstlern. Werke, wenn sie gut sind – wie es Herbst'
Werk ohne Frage ist – sind singuläre Ereignisse – jedenfalls was ihre
Vergleichbarkeit angeht. Man kann einen Rembrandt nicht mit einem
Michelangelo vergleichen. Man kann allerdings in der Ebene zuordnen.
Nichts anderes wollte ich mit dem Vorstehenden erreichen: Eine
Würdigung, wenn auch viel zu verkürzt und unter
literaturwissenschaftlichen Gesichtspunkten vollkommen unzureichend,
eines Autors, der zwar ganz allgemein dem Literaturbetrieb als wichtig
zugestellt wird, dessen Wichtigkeit jedoch unterbewertet ist. Es wird
die Aufgabe meiner Kollegen aus den Printmedien und Universitäten sein,
diese Schwäche zu beheben.
Mit „Meere“ (das Buch war aufgrund einer Gerichtsentscheidung einige
Jahre verboten und ist nun wieder erlaubt) hat Alban Nikolai Herbst ein
Buch geschrieben, welches sowohl kompositorisch, als auch hinsichtlich
der Wortgewalt aus dem Üblichen der deutschsprachigen Literatur
herausragt. Mit einer kolossalen Leichtigkeit, gelingt es ihm zugleich
als Ich-Erzähler und dritte Person teil der Tragödie, denn um eine
solche handelt es sich meiner Meinung nach, und wenn ich das hinzufügen
darf, um eine, welche in ihrem Aufbau und der Dramatik durchaus eine
griechische sein könnte, zu sein. Es ist eine Liebes- und eine
Lebenstragödie; eine autobiografische dazu, die wenn auch
fiktionalisiert, ihre biografischen Wurzeln nicht leugnen kann und mag.
Der in der Mitte des Lebens stehende Maler Fichte trifft auf die
zwanzig Jahre jüngere Irene. Es entspinnt sich, wie ein Gewebe aus
schwerem Brokat, eine Liebesbeziehung voll Obsessionen, tragisch
durchbrochen von den Fäden der Ficht'schen Herkunft. Fichte, der als
Enkel des Kriegsverbrechers von Kalkreuth geboren wurde, wird immer
wieder von den Schatten nicht nur seiner, sondern seiner Familie
Vergangenheit eingeholt. Und so durchdringt das „Er“ des Erzählers
Kalkreuth das „Ich“ der Gestalt „Fichte“, trennt sich von ihr,
vereinigt sich wieder und macht auf eine geradezu gewaltätige Weise die
Zerrissenheit des gemeinsamen Seins beider deutlich.
Die Tragik der Person Kalkreuth-Fichte ist dabei eine dreifache: Da ist
Fichte, der dabei auch Kalkreuth ist, und seine tragödische (hier
tragisch zu schreiben, würde auf den falschen Weg führen) Liebe zu
Irene, die nicht schön, ruhig, erfüllt sein kann, weil sie an ihren
eigenen Zwängen ebenso scheitert, wie an ihren Visionen und einem
Mythos, der ihr inhärent ist von Anfang an. Sie scheitert allerdings
auch an der Demut, mit der sowohl Fichte, als auch Kalkreuth, ihrer
eigenen Phantasmagorie einer zu liebenden Frau anhängen. Fichte kann
nicht glücklich sein, weil es in ihm Kalkreuth gibt und Kalkreuth kann
Glück nicht finden ohne Fichte. Daran sind beide gehemmt: Nicht nur
durch jeweils den anderen, sondern durch ihre jeweilige Schaffung, ihre
Vergangenheit und damit durch ihre Entstehung in der Welt. Der eine
also aufgrund seiner Geburt und der Gespenster, die ihn als Erlebnisse
in Schule und Elternhaus, Kindheit und Jugend verfolgen, der andere,
weil es nicht gelingt, sich neu zu erschaffen über den Erschaffenden,
also Kalkreuth, hinaus. Und so gelingt nicht, die Liebe zu halten. Auch
dann nicht, als Irene ein Kind von Fichte bekommt, ein Kind, dass
wiederum eine Art von Obsession darstellt: Diesmal die des liebenden
Vaters.
Die sexuellen Obsessionen, die unterschwellige Gewalt, die Verzweiflung
und die Lust brechen aus den Seiten hervor in den Kopf des Lesers, wie
eine Naturgewalt. Die Ängste der Figuren, ihre Trauer, ihre
Verzweiflungen – auch an der Aufnahme im Kunstbetriebe (Fichte ist ja
Maler), die Selbstreflektionen Fichtes und Kalkreuths, beider
Ausflüchte, um den schon gewonnenen Einsichten zu entgehen – sie
schaffen es immer, mehr zu sein, als Schilderungen. Sie sind Bilder,
Filme, Sprache die gehört werden kann.
Herbst schildert dabei die vergebliche Suche an vollendeter Liebe
ebenso schonungslos, wie er offen und mit guter Grobheit die Akte der
körperlichen Liebe schildert. Er schont dabei, denn „Meere“ trägt
autobiografische Züge, nicht sich, noch seine handelnden Figuren. Dabei
versteht Herbst es meisterlich mit den Erzählperspektiven und den
Zeiten umzugehen. Auf den letzten Seiten verwischen sich gar
Handlungen, Geschehnisse verweben sich. Es ist, als dringe man auf den
letzten Achttausender der Sprache vor. Und obwohl szenisch und
sprachlich „Meere“ durchgängig ohne Fehler und Makel ist, zeigen diese
letzten Seiten die Kraft des Autors, über jede Üblichkeit von
Darstellung hinauszugehen und dabei nicht akademische
Sorgenkindliteratur abzuliefern, sondern mit neuen Mitteln die
Geschichte zu verstärken.
„Meere“ ist ein Buch, welches, für mich ganz ohne jeden Zweifel, in den
Kanon der deutschen Literatur gehört, der ja fortgeschrieben werden
muss und nicht in der großen und dankenswerten Arbeit Reich-Ranickis
sein Ende gefunden haben darf.
Alban Nikolai Herbst, Meere, 244 Seiten, 20 Euro, 978-3-86638-004-2, Dielmann, FFM